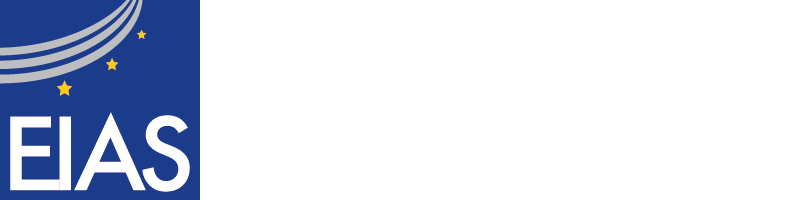Religion und Weltanschauung im Arbeitsleben
Eine Betrachtung aus Sicht des Europäischen, deutschen, französischen und norwegischen Arbeits- und Sozialrechts
Kurzbericht
Professor Dr. Matthias Jacobs, Hamburg, und Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Hauke Rinsdorf, Hamburg
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Dennoch bleibt Broterwerb für die Meisten ein Thema. Auch kann man seine grundlegenden Lebenseinstellungen nicht einfach am Werkstor abgeben. Wie muss also das Arbeitsrecht auf Religion und Weltanschauung Rücksicht nehmen, und welche Zurückhaltung ist vom Arbeitnehmer selbst verlangt? Darf die Religion Anknüpfungspunkt für Auswahlentscheidungen sein, und welche Loyalität können die Kirchen und ihre Einrichtungen verlangen, gerade wenn sie an breiter – vielleicht schon überdehnter – Front im Bereich der Krankenpflege, Altenpflege und sozialer Fürsorge auftreten? Die Antworten, die einzelne nationale Rechtsordnungen auf diese Fragen geben, fallen im Licht variierender staatskirchenrechtlicher Traditionen unterschiedlich aus. Als Katalysator für eine Gleichrichtung wirkt demgegenüber das durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) geprägte Antidiskriminierungsrecht. Auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) kommen von Zeit zu Zeit Weckrufe, die Anlass geben, die eigenen Hörgewohnheiten zu überdenken. Potential für Disruption und Diskussion ist also allemal gegeben, erst recht weil im Mehrebenensystem der Rechtsprechung auch Bundesarbeitsgericht (BAG) und Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ihre Stimme erheben.
Die Teilnehmer der 14. Jahrestagung der Arbeitsgruppe Europäisches und Internationales Arbeits- und Sozialrecht (EIAS), die am 23. und 24.2.2018 in Hamburg an der Bucerius Law School in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Arbeitsgerichtsverband e.V. stattfand, betrachteten die Thematik aus deutscher und europäischer Sicht und im Vergleich mit Frankreich und Norwegen. Deutsches Staatskirchenrecht mit seinen grundgesetzlichen Garantien des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts trifft hier auf laizistische Tradition, aufgeladen mit den Überfremdungsängsten eines Michel Houellebecq. Von den Spannungen in Frankreich doch weit entfernt liegt Norwegen, das zwar die Staatskirche aufgegeben hat, jedoch nach wie vor stark lutherisch geprägt ist. Somit war auch gesellschaftlich ein weites Spannungsfeld aufgebaut, das mitgedacht werden muss, wenn man arbeitsrechtlich diskutiert.
Die Tagungsleitung lag erneut bei Rechtsanwalt Harald Schliemann, Justizminister des Freistaats Thüringen a.D., vormals Vorsitzender Richter am BAG. Die Moderation übernahmen Prof. Dr. Matthias Jacobs, Bucerius Law School, Prof. Dr. Anja Schlewing, Vorsitzende Richterin am BAG, Prof. Dr. Hans-Joachim Bauschke, Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, Nicola Behrend, Richterin am BSG, Rechtsanwalt Dr. Hauke Rinsdorf und Rechtsanwalt Prof. Dr. Achim Schunder, NZA.
Diese Beilage enthält die vorgelegten Tagungsbeiträge.
Prof. Dr. Adam Sagan, Universität Köln/Universität Bayreuth gibt einen Überblick zur aktuellen Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH zum Arbeits- und Sozialrecht. Dr. Johannes Heuschmid, Hugo Sinzheimer Institut, Frankfurt, trägt eine Übersicht zur aktuellen Rechtsprechung des EGMR im arbeitsrechtlichen Kontext und dem dort zu beachtenden Verfahren bei. Eine Einführung in die Diskussion in Frankreich leistet Dr. Patrick Remy, Maître de conférence, Université Paris I (Panthéon-Sorbonne). Melanie Hack, PhD, vormals Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, München, berichtet über die Entwicklung von Gesetzgebung und Rechtsprechung in Norwegen.
Zur Entwicklung des deutschen Arbeitsrechts zum Thema bis hin zu den Vorlagebeschlüssen an den EuGH referierte im Rahmen der Tagung Inken Gallner, Vorsitzende Richterin am BAG, Erfurt. Die sozialrechtliche Dimension in Deutschland, die vor allem auf die Frage der Anpassung von Leistungen an religiöse Bedürfnisse bezogen ist, beleuchtete der Vortrag von Prof. Dr. Katja Nebe, Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg. Die Tagung schloss mit einer Innensicht aus dem „Maschinenraum“ des EuGH. François Biltgen, Richter am EuGH, Luxemburg, berichtete über Möglichkeiten und Grenzen weltanschaulicher und religiöser Positionierung oder auch Neutralisierung im Kontext des Antidiskriminierungsrechts. Wer Ohren hatte, zu hören, nahm hier bereits den Anklang der Position wahr, die der EuGH in seinen beiden Entscheidungen zum kirchlichen Arbeitsrecht (17.04.2018, C-414/16, „Egenberger“; 11.09.2018, C-68/17 „IR“) mit aufrüttelnden Folgen für die Situation in Deutschland eingenommen hat. Herrn Biltgen sei wie allen Mitwirkenden und Teilnehmern für die kenntnisreichen und zum Weiterdenken anregenden Beiträge herzlich gedankt.
Der Beirat dankt zudem ausdrücklich dem Hamburger Verein für Arbeitsrecht e.V. und der NZA für die freundliche Unterstützung.